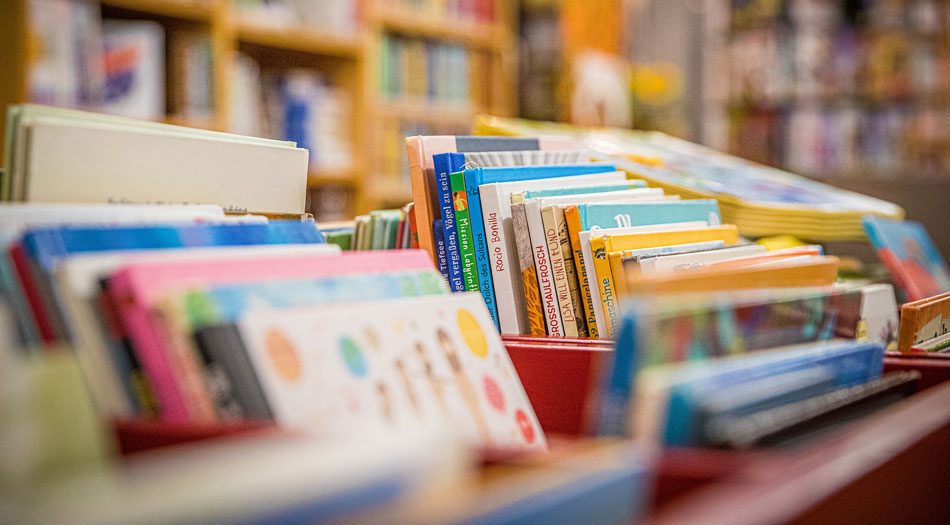Am 31. Juli 2025 ist das Berliner Landesprogramm „Sprach-Kitas“ ausgelaufen. Der Rundbrief Nr. 6 (Juli 2025) der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie – „Vom Impuls zur Haltung“ – fasst zusammen, was erreicht wurde, und zeigt, wie die Inhalte in den Kitas weiterleben können.
Worum ging es bei den „Sprach-Kitas“?
Sprache ist der Schlüssel zu Bildung und Teilhabe. Das Programm „Sprach-Kitas“ hat Kitateams darin unterstützt, Sprachbildung im Alltag zu verankern – also beim Freispiel, beim Essen, Anziehen oder Vorlesen. Im Mittelpunkt standen drei Schwerpunkte:
- Alltagsintegrierte sprachliche Bildung: Kinder werden im normalen Tagesablauf neugierig auf Sprache gemacht – durch offene Fragen, Erzählanlässe, Reime, Bilderbücher und Rituale.
- Inklusive Pädagogik: Jedes Kind erhält passende Zugänge – unabhängig von Hör-, Sprach- oder Lernerfahrungen.
- Zusammenarbeit mit Familien: Eltern werden als Experten für ihr Kind einbezogen; Mehrsprachigkeit wird wertgeschätzt.
Unterstützt wurden die Einrichtungen durch Fachberatung: erfahrene Expertinnen und Experten, die Teams fortbilden, begleiten und bei der Entwicklung passender Lösungen helfen.
Wie der Rundbrief das ausgelaufene Programm einordnet
Der Rundbrief versteht sich als Rückblick und Ausblick: Welche Haltungen und Routinen haben sich bewährt? Welche Materialien helfen, sie zu verstetigen? Enthalten sind z. B. Reflexionsfragen für Teams sowie Anregungen, mit denen Kitas ihre sprachbildende Praxis eigenständig weiterführen können.
Besondere Anerkennung für unsere Eventus-Verbünde
Im Kapitel „2.3 Innere Haltung, äußere Wirkung – Nachhaltigkeit durch gelebte Überzeugung“ werden Beispiele aus den Verbünden der Fachberatung Belgin Kaya hervorgehoben. Träger dieser Fachberatung ist die eventus Bildung gGmbH. Die Beispiele zeigen greifbar, wie kleine Veränderungen im Alltag Großes bewirken:
- Sprache als Teamaufgabe: Pädagogische Fachkräfte nutzen gezielt Dialoge im Tagesablauf, richten „Sprachinseln“ ein und besprechen regelmäßig die Entwicklung einzelner Kinder. Ergebnis: mehr Sprechfreude und Zutrauen – besonders bei Kindern, die gerade Deutsch lernen.
- Inklusion bei Hörbeeinträchtigung: Durch visuelle Tagespläne, bessere Raumakustik und Gebärden in Routinen werden Informationen für alle Kinder klarer – nicht nur für das betroffene Kind.
- Ankommen nach Fluchterfahrung: Mehrsprachige Begrüßungsrituale, diversitätsbewusste Bilderbücher, ein Kulturkalender und ein offenes Elterncafé stärken Zugehörigkeit und Mitgestaltung.
- Herausforderndes Verhalten verstehen: Mit Rückzugsorten, verlässlichen 1:1-Zeiten und kollegialer Fallberatung rückt das Bedürfnis des Kindes in den Fokus – und nicht das „Problem“.
- Partizipative Räume: Barrierearme Möblierung, ein „Ideenbuch“ der Kinder und Kinderkonferenzen fördern Selbstwirksamkeit und Sprachhandeln.
Diese Praxisbeispiele machen deutlich: Nachhaltigkeit entsteht aus Haltung. Wenn Teams Sprache, Teilhabe und Vielfalt konsequent mitdenken, verändern sich Routinen, Räume und das Miteinander – spürbar für Kinder und Familien.
Was bedeutet das Ende des Programms?
Mit dem Auslaufen des Landesprogramms endet die programmgebundene Fachberatung. Die gute Nachricht: Die Inhalte bleiben – in vielen Teams, Konzepten und Materialien. Kitas können weiterhin:
- bewährte Rituale nutzen (Morgenkreis, Bilderbuchgespräche, Erzählrunden),
- Eltern dialogisch einbinden (Tür-und-Angel-Gespräche, Mehrsprachigkeit sichtbar machen),
- regelmäßig im Team reflektieren, wie Sprache im Alltag angeregt wird.
Eine sachliche, kritische Einordnung
Das Ende eines strukturierten Förderprogramms bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich – ohne alarmistische Töne, aber nüchtern betrachtet:
- Kontinuität sichern: Ohne externe Fachberatung droht guten Vorsätzen im Alltag die Zeit zu fehlen. Teams brauchen verbindliche Reflexionszeiten und klare Zuständigkeiten.
- Ungleichheiten vermeiden: Je nach Ressourcen der Träger können sich Qualitätsunterschiede zwischen Einrichtungen vergrößern. Transparente Standards und kollegiale Netzwerke helfen gegenzusteuern.
- Wissen bewahren: Personalwechsel können aufgebautes Know-how schwächen. Dokumentierte Leitfäden und interne Fortbildung halten Erfahrungen lebendig.
- Elternpartnerschaft stärken: Ohne feste Anlässe (z. B. Beratungsangebote) braucht es einfache Formate, damit mehrsprachige Familien weiterhin selbstverständlich eingebunden werden.
Was jetzt hilft: kleine, verlässliche Strukturen – z. B. eine feste monatliche Teamreflexion, ein „Sprach-Impuls der Woche“, ein Pool an Bilderbüchern/Materialien, kollegiale Beratung, ein sichtbarer Kalender für Mehrsprachigkeit und Kulturereignisse sowie die Benennung einer internen Kontaktperson für Sprachbildung und Inklusion.
Was Eltern und Kinder davon merken
- Kinder finden leichter Worte für Gefühle und Bedürfnisse.
- Mehrsprachige Familien erleben Wertschätzung ihrer Sprachen.
- Teilhabe im Alltag wächst – vom Gespräch am Tisch bis zur Kinderkonferenz.
Unser Beitrag als eventus Bildung
Wir danken Belgin Kaya und allen beteiligten Teams in unseren Verbünden herzlich für ihr Engagement. Als eventus Bildung gGmbH unterstützen wir die Qualitätsentwicklung auch weiterhin. Unser Fokus liegt auf praxisnahen Impulsen zu alltagsintegrierter sprachlicher Bildung, Inklusion und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Familien.